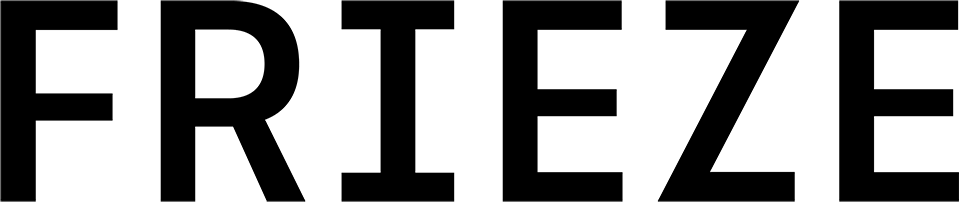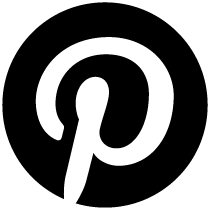Postkarte aus Wien
...eine ziemlich große, eng beschriebene, etwas spät abgeschickte Postkarte von den Ufern der Donau, anlässlich der Vienna Art Week vor einem Monat.
...eine ziemlich große, eng beschriebene, etwas spät abgeschickte Postkarte von den Ufern der Donau, anlässlich der Vienna Art Week vor einem Monat.
English Version here
Wien ist immer wieder ein herrliches Paradox: Man trifft aus der dortigen Kunstszene stets und sofort Leute, die davon berichten werden, woran man mal wieder die Ignoranz des Wiener Bürgertums gegenüber der zeitgenössischen Kunst bemessen kann, welches zwischen Mozart und Kaiserin Sissi doch lieber in Nostalgie für Vergangene Größe der Donaumonarchie schwelge, anstatt sich Modernem und Zeitgenössischem zu öffnen. Und gleichzeitig erlebt man dann in eben jener Stadt eine ziemlich beispiellose institutionelle Ansammlung von genau dem, was den Diskurs über Modernes und Zeitgenössisches gerade umtreibt. Wahrscheinlich genau weil es in Wien immer noch zugespitzt wie nirgendwo diese Spannung gibt zwischen rückwärtsgewandtem Traditionalismus und Sehnsucht nach radikal Anderem und Neuem: Opernball und Film über aktionistische Schreitherapie (Marcel Odenbachs spannender Film gewonnen aus Originalmaterial der Mühlschen AA-Kommune Friedrichshof und gespielten Szenen auf Freuds Londoner Sofa, im Kunstraum der Sammlung Friedrichshof), Adabei-Gesellschaft) und queere Theoriebildung (die Konferenz „Dildo Anus Macht: Queere Abstraktion“ und die begleitende Ausstellung „Rosa Arbeit auf Goldener Straße“, beides in der Akademie der Künste, dort vor allem sehenswert die frühen Filme des deutschen Filmemachers Stefan Hayn, etwa Pissen von 1989/90, welcher in erfrischend unverblümter Art kindliche Scham-Erlebnisse und schwule Initiation gegeneinander zuspitzt).
Im November also die Vienna Art Week, das jährliche Festival ausgerichtet vom Auktionshaus Dorotheum und dem „Art Cluster“, einem Konglomerat von 28 Institutionen inklusive aller wichtigen Wiener Institutionen, vom MUMOK über die Secession und das Kunsthistorische Museum bis zum Verband Österreichischer Privatgalerien. Zahlreiche Podiumsdiskussionen, öffentliche Atelierbesuche, Museumsempfänge und Galerieeröffnungen, und selbst der ehrgeizigste Besucher musste irgendwann zugeben, dass man in ein paar Tagen nur einen Bruchteil all dessen schafft. Alleine die Zahl gleichzeitig in der Stadt zu sehender Einzelausstellungen mit international beachteten Künstlern (von denen ich einige, und dazu andere mehr, im Folgenden näher thematisieren will) war ziemlich beeindruckend: Ed Ruscha, Sharon Lockhart, Dan Flavin, Kerry James Marshall, Michaël Borremans, Pae White, Norbert Schwontkowski, Marina Abramovic, um nur einige zu nennen.
Dazu gab es aus Anlass des Ereignisses eine große thematische Gruppenausstellung,Predicting Memories, kuratiert vom Künstlerischen Leiter der Art Week Robert Punkenhofer und Ursula Maria Probst, in der 1870-73 erbauten k.k. Telegrafen Centrale – ein wieder zu entdeckender, weitestgehend leerstehender Amts-Palast aus eben jener von konservativer Seite so glorifizierten Zeit. Unrenovierte Räume ließen keinen falschen Prunk aufkommen, und die gezeigte Kunst selbst – falls jemand angesichts der Verbindung zu einem Auktionshaus Bedenken gehabt haben sollte – hatte nichts von bloßer Gefälligkeit oder gar marktanbiederndem Bling-Bling. Wobei der Titel durchaus wörtlich zu nehmen ist: „Predicting Memories“, Kunst also, die die gesellschaftlich notwendige Erinnerungsarbeit, die Auseinandersetzung mit blinden Flecken und Traumata der Geschichte, antizipiert. Vom Duo Simone Bader and Jo Schmeiser alias Klub Zwei (benannt nach einer legendären Talkshow im ORF, die heuer zum Jahresende eingestellt wird, hier eine Folge von 1983 mit Joseph Beuys und Peter Weibel) ist eine Filmdokumentation zu sehen: Liebe Geschichte (2010) handelt von Frauen, deren Vorfahren Nazi-Täter waren und die mit diesem Umstand in ihrem Leben zu Rande zu kommen versuchen, von persönlicher Introspektion bis zur aktiven öffentlichen Auseinandersetzung. Die Interviews sind beeindruckend, die Protagonistinnen selbst sind beeindruckend. Nicht wirklich überzeugend aber ist die filmische Kontrastierung mit dem heutigen Stadtbild Wiens: dass die meisten der Interviews an öffentlichen architektonischen Orten gedreht wurden, fügt diesen wenig bis nichts hinzu. Katrin Himmler – Großnichte Heinrich Himmlers und engagierte Autorin in der Auseinandersetzung mit der Geschichte ihrer Familie – vor der Niederlassung der Vereinten Nationen in Wien, was bringt das für ein solches Interview außer einer vagen Referenz auf Nachkriegsgeschichte? Oder Interview mit Blick auf Hans Holleins Ende der Achtziger erbautes postmodernes „Haas-Haus“ am Stephansplatz? Der weitgehende Verzicht auf historisches Footage erscheint vor diesem Hintergrund nicht gerechtfertigt, ebenso wenig wie die Beschränkung auf weibliche Nachkommen – wenn es denn um eine Thematisierung der Unterschiede in der Auseinandersetzung gegangen wäre zwischen Frauen und Männern, hätte man ja um so mehr zum Vergleich eben auch männliche Nachfahren in den Blick nehmen müssen? Trotzdem, im Österreich der „Opferthese“ – noch 2008 hatte Otto von Habsburg auf einer Gedenkveranstaltung der ÖVP Ovationen dafür erhalten, dass Er das Österreich des „Anschluss“ als ersten Opfer Nazi-Deutschlands darstellte – sind solche Auseinandersetzungen mit Verstrickung und Täterschaft immer noch mehr als nur notwendig.
Über die prinzipielle Unterschiedlichkeit verschiedener geschichtlicher Zusammenhänge hinweg schrieb sich die Auseinandersetzung mit Trauma und Stigma weiter in die Ausstellung fort. In Yao Jui-Chungs Long Live (2011), gefilmt auf der taiwanesischen Militärinsel Kinmen nahe der Küste der Volksrepublik, steht ein General in vollem Wichs in der Ruine eines riesigen Kinos und Versammlungssaals, der „Chiang Kai-Chek Hall“ – erbaut zu Zeiten des „Weißen Terrors“ (der Periode konstanten Kriegsrechts in Taiwan 1949 bis 1987) – und ruft immer wieder „Wansui“; wörtlich „zehntausend Jahre“, der traditionelle chinesische Ausdruck für den Ausruf „Lang lebe…“, der sowohl für Mao als auch für seinen taiwanesischen Erzfeind galt. Geschichte erscheint als geisterhafte Beschwörung des längst Untergegangenen, präsent in der Verleugnung wie in der kritischen Reflektion. Ähnlich in den Ruinen vergangener Träume ist Terence Gower zugange, der die Geschichte des österreichischen Erfinders der modernen amerikanischen Shopping Mall, Victor Gruen, anhand einiger weniger Exponate skizzierte – derselbe Victor Gruen, der in den Sechziger Jahren ganze Stadtteile von Tehran errichtete (eingehender und aufschlussreicher zu Gruen und der Shopping Mall: der Dokumentarfilm Der Gruen Effekt von Anette Baldauf und Katharina Weingartner). Julieta Aranda’s „Memory Newspaper“ wiederum lieferte in Form einer frei mitnehmbaren Zeitung philosophische Texte zum Thema Erinnerung, während Kara Walker’s Video Fall Frum Grace, Miss Pip’s Blue Tale (2011), in der von Walker sattsam bekannten grotesken Scherenschnitt-Ästhetik, allerdings diesmal nicht statisch sondern, ähnlich wie bei William Kentridge, als Animation im Stil des chinesischen Schattenspiel. Walker richtet erneut den Blick auf die wie in schrecklichen, märchenhaften Grotesken zugespitzte Realität der Gräuel zu Zeiten der Sklaverei, der Kastrationsangst des Sklavenhalters gegenüber dem männlichen Sklaven, der Angstlust angesichts der Herr-Knechtverhältnisse, und der daraus folgernden Ermordung vermeintlicher oder tatsächlicher schwarzer Nebenbuhler; der Effekt des Unbehagens stellt sich ein durch das „Unangebrachte“ der Darstellung historischen Traumas Unrechts mit Mitteln des „billigen“ Schattentheaters wie aus Vaudeville-Zeiten, inklusive sexueller Deftigkeit – wobei man zwar fragen mag, inwieweit da aktiviert oder betäubt wird, was an geschichtlicher Aufarbeitung möglich wäre; aber nicht vergessen sollte, dass heute noch Leute Filme wie „Gone With the Wind“ (1939) anschauen und dabei erfolgreich die brutale Realität der Sklaverei ausblenden oder gar gutheißen. Und angesichts der Politik von NRA und Tea Party muss man sich eh keinen Illusionen hingeben, dass mit einem baldigen Aussterben des weißen Suprematismus zu rechnen ist.

Womit wir bei Kerry James Marshalls Anfang Dezember zu Ende gegangener Ausstellung in der Secession wären, der stereotype Darstellungen von Afroamerikanern auf seine, malerische Weise aushebelte. Der große Hauptraum der Secession ist die perfekte Arena für seine großformatigen Leinwände, die die „Black Aesthetics“, wie Marshall selbst es nennt, als einen Resonanzraum für politischen Kampf ebenso wie für die mikrosozialen Feinheiten des täglichen Zusammenlebens begreift. Mein Lieblingsbild zeigt einen Frisiersalon, mutmaßlich am geschäftigen Freitagnachmittag, eine veritable School of Beauty School of Culture (2012). In der Mitte des Bildes spielen zwei kleine Kinder an einer seltsam amorphen Farbfläche – die sich aus der schrägen Sicht als Anamorphose eines blond-weißen Mädchenkopfs entpuppt; das Barbie-Regime erscheint als das „Reale“ des Bildes, als überschattende Vanitas, so wie einst der Totenkopf bei Hans Hohlbeins Gesandten von 1533 – sicher ebenso eine bewusste Anspielung Marshalls wie jene Spiegelung in der Mitte, die wiederum auf Velasquez’ Las Meninas von 1656 referiert. Überhaupt setzen sich die selbstbewussten malerischen Referenzen fort: schon der Ausstellungstitel “Who’s Afraid of Red, Black and Green” verbindet Barnett Newmans berühmtes Bild Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue (1966) unmittelbar mit den Farben der 1920 etablierten pan-afrikanischen Flagge. Und zu Klimts weltberühmten Beethoven-Fries gesellte er ein Robert Johnson Frieze (2012) hinzu; der orchestrale Klassiker und der Blues-Klassiker. Formalistischer Kunstdiskurs und politische Infragestellung des weißen kulturellen Kanons werden unmittelbar verknüpft.
Gerade die Straße hoch hinter der Secession, einen Steinwurf entfernt in der Galerie Mezzanin, die Ausstellung von Christian Mayer: Geschichtsschreibung und Neuvorlage von Erinnerung spielt auch bei ihm eine zentrale Rolle. Aber beim zeitlichen Horizont geht Mayer gleich ein mal in die Millionen. Ausgangspunkt ist die seltsame Geschichte vom Samenkorn, dass ein Eiszeit-Eichhörnchen vor 32.000 im sibirischen Permafrost vergraben hat und das heute reanimiert werden konnte; Mayer verwendet die Aufnahme jenes von russischen Wissenschaftlern hochgepäppelten Pflänzchen und reproduziert es im ebenfalls beinahe ausgestorbenen und von ihm reanimierten, überaus edlen Dye Transfer. Die Dopplung/Paarung von Naturgeschichte und Technologie in Form eines konservierten Samenkorns, repräsentiert mittels eines konservierten Fotodruck-Verfahrens, spinnt Mayer weiter mit der Idee der Zeitkapsel: er zeigt Allochtone, 200 Millionen Jahre alte versteinerte Baumstämme aus Madagaskar, handlich groß wie eine Brankusi-Skulptur, von der Natur gemachte Readymades; aber auch eine Serie von aus Zeitungsarchiven stammenden Schwarzweißfotos, die das Erstellen und Deponieren von Zeitkapseln – also Behältern mit Erinnerungsstücken für spätere Generationen – etwa beim Grundsteinlegen eines Chicagoer Bürogebäudes 1963 dokumentieren.
Überhaupt scheint für zeitgenössische Künstler die Vorstellung immer wieder faszinierend, aus der Perspektive einer gerade mal ca. 100 Jahre alten Idee – der Idee einer zeitgenössischen Kunst nach Duchamp, die ihre eigenen gegenwärtigen Bedingungen des Zeigens zum ausdrücklichen Gegenstand macht – zurückzublicken in die Epochen, wenn nicht die Jahrmillionen. Alte Meister, Steine, Kristalle. Ed Ruscha fasst das natürlich in eine ironische Verkehrung: „The Ancients Stole All Our Great Ideas“ hieß seine Anfang Dezember zu Ende gegangene Ausstellung im Kunsthistorischen Museum, Auftakt einer Serie von Schauen, bei der zeitgenössische Künstler eingeladen sind, aus der Sammlung des weltberühmten Museums Stücke für eine von ihnen zu kuratierende Präsentation auszuwählen. Und bei den „Great Ideas“ sind sogar Dinge eingeschlossen, die nicht von Menschen gemacht sind: ein kleiner Meteorit und ein riesiges Aragonit-Kristall aus den Beständen des nahen Naturhistorischen Museums etwa. Eine idiosynkratische Wunderkammer-Auswahl, zugleich als Anmerkungen zum eigenen Werk zu verstehen: angefangen damit, dass Ruscha einen ausgestopften Schakal und eine Schlange inkludiert, als Hinweis auf die kalifornische Wüsten und deren Gemütshorizont. Katalogisierte Marienkäfer erscheinen aus Ruschas Augen wie eine minimalistische Wandarbeit: „Großartige Kreaturen aufgereiht, während das obsessive Katalogisieren die Faszination und Verwunderung der sie sammelnden menschlichen Wesen offenbart. Hier trifft Natur definitiv auf Kunst. Das simple Arrangement stellt einen ästhetischen Triumph dar.“ Das ist einerseits so gemeint wie gesagt, aber andererseits ist die rhetorische Zuspitzung – in Reih und Glied aufgespießte Marienkäfer als „ästhetischer Triumph“ – zugleich ein mit versteinerter Miene gemachter Witz über die Ästhetik von Konzeptkunst und Minimal Art. Weitere Preziosen – Exponate aus der Wunderkammer des Schlos Ambras in Innsbruck, etwa ein aus dem 16. Jahrhundert stammendes Dodecahedron (ein aus Fünfecken gebildeter Körper) mit Mini-Kopfporträts, die als Vexierbild von oben wie unten ein Gesicht ergeben – setzten diesen Schmäh ebenso fort wie nach subjektiven Kriterien ausgewählte alte Meister: Arcimboldo-Gemüsenasen ebenso wie den Rubens, den Ruscha für den blutroten Abendhimmel ausgewählt hat, der ihn natürlich an eigene Bilder erinnert.
Zeitgenössische Künster zu bitten, historischen Sammlungen ihren unorthodoxen Blick zu leihen, gilt eh als Königsweg. So auch im MAK, dass sich unter dem neuen Direktor Christoph Thun-Hohenstein wieder stärker den „Kernaufgaben“ Angewandte Kunst / Gestaltung widmen will. Dort ist es Pae White, wie Ruscha aus Kalifornien. White dreht ihre Kunst sowieso schon ausgiebig in Richtung Designfragen – oder eigentlich, besser gesagt, bringt sie die Textur- und Material-Obsessionen der Gebrauchs- und Gestaltungswelt unter der Hand in die Kunst hinein. Entsprechend überrascht es nicht, dass der von ihr kuratierte Teil der Neupräsentation der Wiener-Werkstätten-Sammlung den Akzent nicht auf die üblichen ikonischen Stühle oder Bilder oder Namen legt – von Josef Hoffmann über Koloman Moser bis Klimt – sondern auf anonyme Designs für Tapeten, Geschenkpapier, Grußkarten oder Marmeladenglasetiketten, die die typisch überbordende, teils orientalisierende, teils geometrisch-psychedelische Ästhetik aufweisen, nur eben nicht mit den berühmten Namen versehen sind und kein Gegenstand im engeren Sinne sind, sondern eben Verpackung. Das ist vielleicht auch das konzeptuelle, pop-minimalistische Erbe bei Pae White: dass man solche Artefakte aufwertet als „eigentliche“ Essenz des Kanons, der sonst – auch hier wieder im Stockwerk tiefer – fast ausschließlich über traditionelle Werte des edlen Interieur-Objekts definiert wird. Bei White wie Ruscha stellt sich allerdings die Frage, da es in beiden Fällen Auftakt für jährlich wiederkehrende Interventionen zeitgenössischer Künstler in kunsthistorische Sammlungen sein sollen, wie oft sich diese Geste des „subversiven“ oder „schrägen“ Eingriffs wiederholen lässt, bevor sie selbst verbraucht und ausgeleiert ist. Wäre die zeitgenössische Kunst auf Dauer nicht doch besser als Fremdkörper in diesen Häusern zugegen, der seinen eigenen Gesetzen folgt und so ex negativo Reibungspunkte zu Angewandtem und zur Tradition liefert, anstatt sich als kuratorischer Erntehelfer zu verdingen? So oder so bin ich gespannt, wie’s weitergeht.
Mit Sharon Lockhart bei TBA21 im Atelier Augarten setzte sich, als hätte es eine telepathische Übereinkunft gegeben, das Thema kalifornischer Blick auf historisch Angewandtes fort. Lockhart – wie White und Ruscha aus Los Angeles – widmet sich ganz ausgiebig der Tanzchoreografin und Textildesignerin Noa Eshkol, auf deren Nachlass Lockhart 2008 in Israel stieß. In einer Fünfkanal-Videoinstallation sehen wir Tänzer, die zum strikten Takt des Metronoms Eshkols komplexe, abstrakte Bewegungen fließend ausagieren, dazu als Bühnenelement nur einzelne Wandteppiche, die Eshkol in Patchwork-Technik aus gefundenen Textilteilen gefertigt hatte, die sie aus Kibbutzen und örtlichen Textilfabriken sammeln ließ. Konzeptuelles Kernstück bei Eshkol ist ihr zusammen mit dem Architekten Avraham Wachman entwickeltes Eshkol-Wachman Movement Notation System, das die beiden zuerst 1958 veröffentlichten; es zeichnet Körperbewegungen in geometrischen Mustern auf als eine Art 3D-Animation des Leonardoschen anthropometischen Zirkels. Lockhart setzt dies um mit einer Reihe von 22 Fotos der von Eshkol und Wachman zu didaktischen Zwecken angefertigten Drahtkugeln, in den gebogene Flächen oder einfache Dreiecke die Bewegungen der Extremitäten darstellen (Models of Orbits in the System of Reference, Eshkol-Wachman Movement Notation System, 2012). Auch hier ist wie bei Pae White das Aufspüren eines konzeptuell-minimalistischen Erbes avant la lettre zu spüren, ebenso wie ein genaues Abtasten der Grenze zwischen Abstraktion und Angewandtem. Ich muss gestehen, dass ich nie großen Enthusiasmus für getreue künstlerische Aufarbeitungen modernistischer Pionierleistungen aufbringen konnte, aber es bleibt unbenommen, dass sowohl die Artefakte der anonymen Designer der Wiener Werkstätten wie die Choreographien und Konzepte Eshkols die ihnen entgegengebrachte Aufmerksamkeit verdienen.
Das gilt auch für die Gebäude der Sowjetmoderne! Im Architekturzentrum Wien ist noch bis 25. Februar eine sehr interessante Ausstellung zur Nachkriegsarchitektur in den nichtrussischen Sowjetrepubliken zwischen 1955 und 1991 zu sehen. 1990 hatte ich das Glück, eine Reise nach Baku, Aserbaidschan machen zu können, in denen ich auch einige der hier gezeigten Gebäude von innen sah – das große Hotel am Rathausplatz, den Lenin-Palast (ein Konzert- und Kongresshaus), den Basar. Man muss die Augen vor den diktatorischen Bedingungen, unter denen all dies errichtet wurde, nicht verschließen, um dennoch die teils bizarr Politbüro-Barock-haften, teils strikt funktionalistischen, dabei dennoch oft modernistisch-eleganten Ästhetiken goutieren zu können, die zwischen Baltikum und Zentralasien zum Tragen kamen. Vor allem auch die Anverwandlungen des post-konstruktivistischen Ideals an politische und lokale Bedingungen: etwas das Genre des „Hochzeitspalastes“, das der Tatsache geschuldet war, dass man eine sozialistische Alternative zum zeremoniellen Pathos der bekämpften Kirche bieten musste. Vieles davon wird mit dieser akribisch recherchierten Ausstellung und dem umfangreichen begleitenden Katalog erstmals dokumentiert – während die Gebäude teils schon wieder verfallen.
Geradezu frühmodernistisch wirkte dazu im Vergleich Dan Flavin, dem eine große Retrospektive im benachbarten Mumok gewidmet ist (noch bis 3. Februar). Ein ganzer Saal ist für die Reihe der um 1964 entstandenen Neon-Arbeiten reserviert, die sich um Tatlins Denkmal für die 3. Internationale (1920) drehen. Die Neons erinnern an Wolkenkratzer, in weiß und ohne Spuren, kein sichtbar verlegten Leitungen; alles sehr klassisch im White Cube, keine Brüche, extrem clean. So wie Flavin es sicher wollte; er wird in der Ausstellung so zitiert: „Ich kann die gewöhnliche Lampe aus dem Gebrauch herauslösen und in eine Magie überführen, die an uralte Mysterien rührt. Und doch ist es immer noch nur eine Lampe, die verlöschen wird wie jede andere ihrer Art.“ Das Ziel geschichtlicher Selbstverewigung konstrastiert mit hehrem Bewusstsein um zukünftige Vergänglichkeit, in der Gegenwart vorweg genommen.
Einen schrill-schönen Dreiklang ergab angesichts dieses Kontrasts zwischen kleinteilig zerklüftetem postkonstruktivistischem Erbe in den Sowjetrepubliken und dem extrem selbstbewussten Purismus eines Flavin eine dritte Ausstellung im Museumsquartier: Nackte Männer im Leopold Museum. Offenbar war eine zeitgleich zum gleichen Thema eingerichtete Ausstellung im Lentos in Linz zuerst mit der Idee publik gewesen, sich diesem bislang erstaunlich wenig erschlossenen Zugangs zur Kunstgeschichte zu widmen. So oder so machte der Gang durchs Leopold Spaß. Neben Kuriosa – Kraftmänner auf alten Schwarzweißfotografien, deren Gemächt mit umständlich angebrachten Feigenblättern verhüllt ist – fielen vor allem ein paar herausragenden Einzelstücke auf. Gegenwärtige Klassiker von Felix Gonzalez-Torres oder Wolfgang Tillmans darf ich als bekannt voraussetzen; mir bislang unbekannt war dagegen die großartige Malerei des früh gestorbenen Franz Gerstl, Geliebter von Arnold Schoenbergs Frau Mathilde, der sich fünfundzwanzigjährig das Leben nahm. Ein frontales Selbstporträt im um die Hüfte geschlungenen weißen Badetuch, intensiver Blick von 1904/1905, symbolistisch in seiner Zeit und doch irgendwie wie aus der Facebook-Gegenwart; für mich spannender als mancher Schiele.
Wie passend, dass zwei gegenwärtige Maler in der Stadt starke Ausstellungen gehängt haben – die allerdings in kaum einem stärkeren Kontrast stehen könnten. Wahre Antipoden: Michaël Borremans und Norbert Schwontkowski. Borremans zeigt in der Bawag Contemporary – ein Ort, an dem Kuratorin Christine Kintisch in den letzten Jahren ein Highlight nach dem anderen hinlegte – eine ultra-präzise und sparsam gehängte Ausstellung, kleine altmeisterlich gemalte Leinwände mit beinahe erdrückend unerbittlichen Kontrollansichten auf die Performanz von Geschlecht und Körper und Geist. Jeder Anflug von väterlicher Wärme, der noch bei Richters Betty mitschwingen soll, jede verklärte Vermeer-Romantik der zärtlich-voyeuristischen Erhaschung weiblicher Schönheit – gezeigt sind vornehmlich junge Frauen und Mädchen in bürgerlich-avantgardistisch wirkenden Kleidern, die teilweise Borremans in seinem Genter Atelier Modell standen – wird hier wie mit dem Pathologen-Besteck seziert. Was zugleich keineswegs heißt, dass Borremans gefühllos malt; im Gegenteil, es ist gerade das Bewusstsein um die Untiefen der Darstellungsklischees, die ihn so kalt und gnadenlos auf die Nacken und Profile blicken lässt.
Norbert Schwontkowski mit seiner Ausstellung in den vor einem Jahr eröffneten Wiener Räumen der Innsbrucker Galerie Elisabeth & Klaus Thoman (bis 26. Februar) macht in jeder Hinsicht das komplette Gegenteil und ist doch gerade deshalb ein ebenbürtiger Maler. Statt Unheimlichkeit und Kälte eine humorvolle, freche Wärme. Statt ultrapräziser Hängung ein bewusst nachlässiges „ach, da ist auch noch Platz“, sich hinweg setzend über das längst eine eigene Konvention gewordene Ideal der ausbalancierten Ausstellungschoreographie. Statt altmeisterlicher Pinselführung eine fromm-fröhliche Schnelligkeit – alle Bilder der Ausstellung entstanden in den vier Monaten zuvor – die jedoch, wie könnte es anders sein, gerade dadurch die sichere Hand und Reife einer über Jahrzehnte geschulten malerischen Genauigkeit offenbart. Mein Lieblingsbild ist Wo Der Mensch Herkommt (2012), ein wie durch’s Watt über die graue Leinwand stapfendes nacktes Beinpaar von hinten, in Taucherflossen steckend – die Ursprungsgeschichte vom aus dem Meer stammenden Landlebewesen wird zur gekonnten Situationskomik: wo wir WIRKLICH herkommen ist die Scham und die Peinlichkeit.
Mit welchen Stichworten könnte man besser eine Wien-Kolumne beenden als mit diesen (peinliches Selbstlob), denn da sind die Wiener traditionell Meister: mit unerbittlicher Präzision die gesellschaftlichen Peinlichkeitspotentiale ausloten, sozusagen Borremans und Schwontkowski auf einmal. Aber – das zeigt die Vienna Art Week Jahr um Jahr im November – zugleich können Wiener Institutionen und Galerien aber auch völlig unpeinlich hochkarätige Ausstellungen auf die Beine stellen, wie sie in solcher Gleichzeitigkeit und Fülle nur an wenigen anderen Orten weltweit vorstellbar sind.