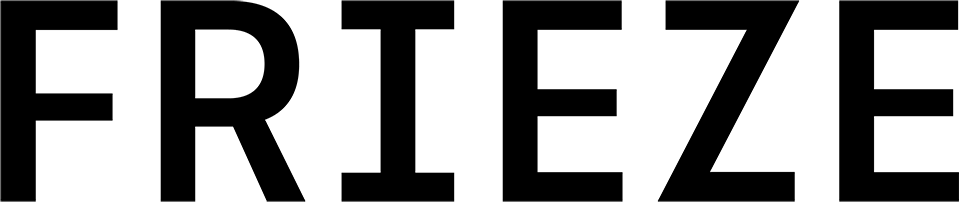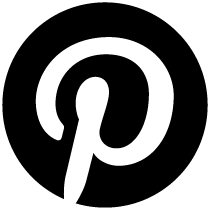Andrea Büttner
Museum Ludwig
Museum Ludwig

Ihre Ausstellung nennt Andrea Büttner lapidar 2. Macht aber auch Sinn, denn sie ist stringent in und um Dichotomien herum organisiert: zwei Räume, ein heller, ein dunkler, zwei große Werkgruppen (plus ein paar kleinere). Und thematisch: Mann und Frau, Kunst und Philosophie, Zerstörung und Aufbau, Bauch und Kopf.
Der dunkle Raum rechts flackert im Licht einer ganzen Reihe von Videoprojektionen (Piano Destructions, 2014). Während auf der Stirnseite der ruhige Mitschnitt eines wunderschönen Konzerts läuft, das Büttner im Frühjahr diesen Jahres mit neun Pianistinnen in der Walter Phillips Gallery im kanadischen Banff organisiert hat, sind auf der Längsseite vier Projektionen zu sehen, die das genaue Gegenteil zeigen: ein Best-of der Klavierzerstörung. Männer – und es sind fast ausschließlich Männer: Raphael Ortiz, George Maciunas, Ben Vautier, Joseph Beuys, Günther Uecker usw. – hacken mit Äxten auf Klaviere ein, ziehen das ehrenwerte Instrument mit einem Kran in die Höhe und lassen es fallen, schubsen das Klavier immer wieder um, bearbeiten es mit Presslufthammern oder treiben Nägel durch seinen hölzernen Korpus. Avantgardistische Instrumentenfolter. Die Message ist klar: hier die wüste, ungezügelte Zerstörungswut und historischer Fluxus-Furor, dort die elegisch-konzentrierte Aktion eines gemeinsamen, hochvirtuosen Konzerts klassischer Anmutung. Kakophonie und Dissonanz auf der einen Seite, Harmonie und Unisono auf der anderen. Männer hier, Frauen dort. Wie das so ist mit Zuspitzungen, funktioniert das ganz gut, ist aber auch ein bisschen didaktisch.
Spannender wird es, wenn man den zweiten, hellen Raum betritt. Hier nämlich ist plötzlich nichts mehr so klar und eindeutig, wie es drüben – im ironischerweise dunklen Raum – scheint. Drei großformatige Fotos von Rampen sind zu sehen, die Bordsteine überbrücken, eine Reihe von abstrakten Holzschnitten und einfachen Hinterglasmalereien; an der hinteren Wand hängt eine riesenhafte Fototapete mit Flatscreen-Motiv, darauf zwei Holzschnitte, für die Büttner ein auseinander genommenes Klavier verwendet hat. Die Verfugung der Klavierperformances entlang der Gender-Achse war konkret und direkt, hier aber wird diese gerade erst etablierte Eindeutigkeit gleich wieder in Abstraktion zerlegt: Argumente zu Farbflächen. Das Hauptwerk in diesem Raum versucht sich dann an einer Synthese: Bilder in der Kritik der Urteilskraft (2014) ist eine Serie von elf großformatigen Planen mit Bildersammlungen, die entfernt an Aby Warburgs Mnemosyne-Atlas erinnern. Büttner hat hierfür Bilder zusammengesucht, die Immanuel Kant in seiner Kritik der Urteilskraft (1790) „beim Schreiben vor Augen gehabt haben könnte“ oder die „beim Lesen vor Augen treten“, wie es der Begleittext formuliert: Tapetenmuster, Kristalle, Moose, Gärten, Evolutionsdarstellungen, wuchtige Deckengemälde, Altes, Neues, Fotos, Stiche, Drucke. Und so wie Kant in der Urteilskraft die Vermittlung von praktischer und theoretischer Vernunft sah, möchte Büttner hier diffuses Gefühl mit klarem Gedanken verbinden, spontanen emotionalen Eindruck mit präziser Überlegung.
Am Ende könnte man da fast so etwas wie eine Büttnersche Minimaldefinition von Kunst herauslesen: Kunst machen, das heißt, trockenes Konzept ebenso wie ästhetische Wirkung zu berücksichtigen, Verstand und Gefühl gleichermaßen zu aktivieren – und beide Seiten dabei vorsichtig miteinander verfugen: Kontexte, Konnotationen und kulturelle Prädispositionen ansprechen, Referentialismus aber nicht exklusiv werden lassen; Platz lassen für einen direkten, ruhig auch diffusen Gefühlseindruck, sich damit aber nicht begnügen. Die Kunst besteht darin, wie man beides miteinander verzahnt.
Und auch wenn es in dieser über die Maßen stringenten und präzisen Ausstellung so scheint, als stehe das Konzept dann eben doch an erster Stelle, ist die Sache komplizierter. Gefühl ist mehr als ein Effekt des Verstandes, und Virtuosität mehr als ein Name für Laissez-faire auf hohem Niveau. Man muss nur auf die neun Pianistinnen in Büttners Performance gucken. Sie spielen mit absoluter Konzentration, schlagen die Tasten mit der größtmöglichen Akkuratesse so gut wie unisono an. Sanft wiegen sie ihre Oberkörper dazu: Ergriffen-Sein auf der Basis ausgefeilter Technik, Sich-gehen-Lassen aus dem Geiste eisenharter Disziplin. Der Takt kommt aus dem Körper und das Gefühl steigt in den Kopf. Aber das bedeutet noch lange nicht Urlaub fürs Gehirn.