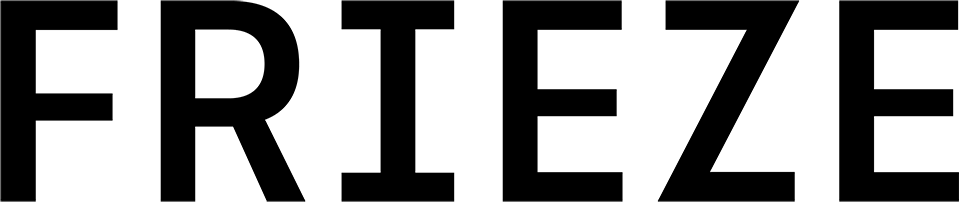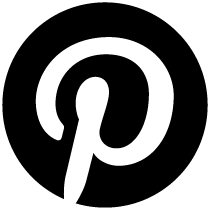A nice mess
digital music
digital music

Im Zeitalter digitaler Reproduzierbarkeit hat es ein Ende mit der Endgültigkeit des Kunstwerks. Popmusik ist endlos remixbar, die definitive, in Stein gemeißelte Version eines Songs ist Vergangenheit. Kulturpessimisten dürfen sich in ihrer Technik-Skepsis bestätigt fühlen, wenn ihnen bewusst wird, dass im Neologismus Mixabilität die beiden großen Imperative des Neoliberalismus lauern: Mobilität und Flexibilität. Der mixende DJ ist, wie der Fußballprofi, qua Job-Profil ein Pionier globalisierten Ich-Unternehmertums. Ist demnach der Mix eine teuflische Erfindung aus den Geheimlaboren des digitalen Kapitalismus? Ist Mixabilität eine weitere Kernanforderung im neoliberalen Alltag? Ein schleichendes Gift, das Individualität aushöhlt und Originale entwertet? Und wo bleibt der Autor? Verschwimmt im Mix die Grenze zwischen Produzent und Konsument zugunsten des Prosumenten?
Ein Blick auf drei aktuelle Mix-Alben zeigt drei verschiedene Ansätze. Fangen wir an mit Gil Scott-Heron. The Revolution will not be televised mit dieser Parole schrieb sich der Meister des politischen Sprechgesangs zu Soul-Jazz-Begleitung in den 1970ern in die Geschichte ein, als Pate des modernen Rap. Auf seine alten Tage muss er sich jetzt mit der digitalen Revolution anfreunden. Und mit einem Typen, der sein Enkel sein könnte. Jamie xx, Kopf von The xx, remixt Gil Scott-Heron. Ein sehr spezielles Setting, weit weg von der Remixt-du-mich-Remix-ich-dich-Tauschökonomie. Die Kombination unterläuft gängige Zuschreibungen. Eigentlich trennt die beiden so viel: Atlantik, Alter, Hautfarbe, digital gap. Jamies Band The xx gewinnt 2009 den Mercury Prize, sie werden Popstars und sind Vorboten des hybriden Bastard-Entwurfs der 2010er Jahre, der mangels besserer Schlagworte mit Entschleunigung und Post-Dubstep versehen wird. Für Gil Scott-Heron in New York sind das böhmische Dörfer.
Als Rohmaterial dient Scott-Herons Album Im New Here von 2010. Jamie xx geht äußerst freizügig mit dem Material um. Statt jeden einzelnen Song neu abzumischen, zerschneidet und rekom- biniert er das komplette Album und fügt Vokal-Stücke aus Scott-Herons glorreicher Vergangenheit ein. So wird aus Im New Here mittels Cut & Paste Were New Here (2011). Am Anfang steht ein doppelt selbstreflexives Statement: I did not become someone different, that I did not want to be, krächzt Scott-Heron ohne Musikbegleitung mit aller Zahnlosigkeit, zu der er fähig ist. Ein kranker alter Mann behauptet seine Würde: Ich bin kein Anderer geworden durch diesen neumodischen Remix-Quatsch, keiner, der ich nicht sein wollte. Der program- matische Auftakt zu einem Album, das Scott-Heron zu einem ganz Anderen macht, ohne ihn zu verraten.
Eine ganz andere Mix-Autorin ist DJ Marcelle. Ihr Album Another Nice Mess Meets More Soulmates At Faust Studio Deejay Laboratory (2010) bezeichnet sie als Feier musikalischer Inspiration und persönli- cher Freundschaft weltweit, ihr ewiger Dank gilt John Peel, der Mutter aller Eklektiker am DJ-Pult. Maximale Materialdichte auf minimalem Raum, Mixen als Hochleistungssport das ist der Ansatz der Niederländerin. Sie kombiniert weibliche Jodler des afrikanischen Volks der Chewa mit Stücken der deutschen Experimentalmusiker FM Einheit und Hans-Joachim Irmler (Faust), die Dub-Dekonstruktivisten Hey-O-Hansen mit Geräuschen aus der Tierwelt, westafrikanische Blues-Wurzeln von Dela Kanuteh und Mawdo Suso mit dem Sound von Güterzügen und Lokomotiven. Wundersamerweise klingt das Resultat nicht nach einer Freakshow mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, sondern nach einem extrem verdichteten Info-Groove, ein Sound, der dem dummen Wort von der Weltmusik neuen Sinn gibt. Another Nice Mess… very nice. Und undenkbar ohne den grenzenlosen Zugang zu den digitalen Archiven.
Wuppdeckmischmampflow. Im lautmalerisch-programmatischen Titel von Robag Wruhmes Album steckt der Mix ebenso drin wie das Werkzeug, an dem er entsteht. Allerdings endet die Arbeit des Mix-Autors nicht am Platten- Deck: Robag Wruhme greift in die Plattenkiste, bringt seine Lieblingstracks in einem feinen Mix zusammen und lässt dabei alles durch den eigenen Filter der Lieblingsgroovesamples laufen, so dass man irgendwann mittendrin den Überblick verliert, ob das noch Stücke sind, oder längst die Vereinnahmung von allem in das Sounduniversum von Robag. Vielleicht beides. Die Beschreibung von Bleed alias Sascha Kösch im DE:BUG-Magazin besetzt positiv, was Kulturpessimisten Angst macht vor der Mixology: Kontingenz zulassen, Überblick verlieren, Kontrollverlust genießen. Alles Eigenschaften, die bis dato gerade nicht neoliberalen Haltungen entsprechen.
Bei allen Unterschieden haben diese drei Mix-Alben eines gemeinsam: Sie sind weiter als die Sprache, die uns zur Verfügung steht, um sie in Worte zu fassen. Das zeigt sich am immer wieder hilflosen Versuch, die globalisierte Musik zu lokalisieren, buchstäblich zu erden. Im Musikmagazin Skug hieß es beispielsweise, DJ Marcelles Herkunft aus den Niederlanden habe sie natürlich insofern geprägt, als dadurch auch der Sound eines multi-ethnischen Umfeldes und Musik der ganzen Welt zu ihrem Erfahrungsschatz geworden sind. Robag Wruhme alias Gabor Schablitzky kommt aus der einstigen Glasstadt Jena; sollte das nach dieser Logik für ihn Grund sein, viel Deutsches zu verwenden? Schollentechno? Quatsch. Die meisten der von ihm vermixten Produzenten verbringen mehr Zeit im Flugzeug als zu Hause und haben, egal wo sie ursprünglich herkommen, ihren Wohnsitz in einer zunehmend internationalisierten Metropole. In Berlin.