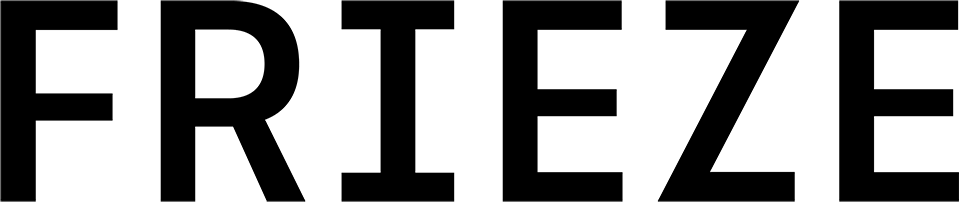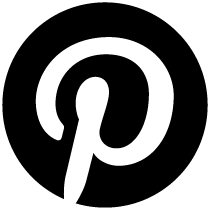Wo der Boden zerstört wurde, wird die Arbeit fortgesetzt?
Im Vorfeld von Maria Eichhorns Beitrag für den deutschen Pavillon stellt Adam Szymczyk Überlegungen hinsichtlich der Frage an, in welcher Form die Künstlerin das Thema Zugänglichkeit aufgreifen wird – angesichts einer Welt, die um den Begriff der Grenze herum organisiert ist.
Im Vorfeld von Maria Eichhorns Beitrag für den deutschen Pavillon stellt Adam Szymczyk Überlegungen hinsichtlich der Frage an, in welcher Form die Künstlerin das Thema Zugänglichkeit aufgreifen wird – angesichts einer Welt, die um den Begriff der Grenze herum organisiert ist.

Um diesen Artikel auf Englisch zu lesen, klicken Sie hier.
Ab wann ist etwas altertümlich und was ist zeitgenössisch? Und was ist es, das den deutschen Pavillon bei der Biennale von Venedig so andersartig, so reizvoll macht? Die Berliner Künstlerin Maria Eichhorn wurde dieses Jahr eingeladen, Deutschland in Venedig zu vertreten. In der für sie charakteristischen Kürze und Bescheidenheit, die an Ironie grenzt, räumt sie bewusst „wie ernsthaft und verantwortungsvoll sich Künstler*innen vor mir mit dieser Aufgabe verknüpft haben“.1 Eichhorn legt sorgfältig dar, dass sie die Verantwortung, in ihren Arbeiten auf die Geschichte zu sprechen zu kommen, stets als eine gegenwartsbezogene Aufgabe versteht und weniger als eine unveränderliche Verpflichtung: „Meine Arbeiten befassen sich vor allem mit der Gegenwart. Also: Wie gehen wir heute mit den Nachwirkungen unserer Geschichte um? Der Pavillon ist natürlich auch Teil der Geschichte und wir sind heute davon beeinflusst, ob wir wollen oder nicht. Aber man muss sich nicht mit dem Pavillon befassen. Wobei sich Künstlerinnen und Künstler immer wieder mit ihren Beiträgen ortsspezifisch geäußert haben. Es ist interessant, dass dieser Pavillon so eine Ortsbezogenheit herausfordert. Es gab aber auch Beiträge, die sich davon distanziert haben, oder sich von der Distanzierung distanziert haben.“2 Diese letzte Wendung gibt einen entscheidenden Hinweis darauf, wie Eichhorn die Geschichte vor dem Hintergrund der gegenwärtigen politischen Situation einer globalisierten Welt in ihrer Arbeit kritisch zu reflektieren vermag. Die politische Geografie der Giardini, wo über 30 Länder ihre Pavillons errichtet haben, während andere teilnehmende Nationen ihre Räumlichkeiten außerhalb des Geländes anmieten müssen, ist seit langem unverändert und wirkt völlig anachronistisch. Das Sediment des 20. Jahrhunderts, in Form der staatlichen Gebäude, welche die Gärten für sich vereinnahmen, wird sogar noch greifbarer bei einem Besuch außerhalb der Saison, wenn sich die Pavillons seltsam verlassen anfühlen, ausgehöhlt, ihrer nationalistischen Ansprüche und des nationalistischen Stolzes entledigt.

Das Bauwerk, heute bekannt als der deutsche Pavillon, wurde 1909 von dem in Mailand geborenen Architekten Daniele Donghi im Stil der Neo-Renaissance als „Padiglione Bavarese“ (Bayrischer Pavillon) errichtet. 1938 wurde dieser auf Initiative von Adolf Ziegler, Präsident der Reichskammer der bildenden Künste, einer institutionellen Transformation unterzogen und zu einem Zweig des Hauses der Deutschen Kunst in München erklärt. Im Zuge dessen wurde der Pavillon dem neuen Geist entsprechend umgestaltet. Verantwortlich dafür war der Architekt Ernst Haiger, der einige andere Gebäude in Nazideutschland sowie die Bar des heutigen Hauses der Kunst in München zu verantworten hat. Für gegenwärtige Besucher*innen strahlt der deutsche Pavillon immer noch die kalte, würdevolle Eleganz der Umgestaltung der 1930er Jahre aus – trotz der Entfernung der Nazisymbole von der Fassade und der Veränderung der Innenausstattung in der Nachkriegszeit, die darauf abzielte, die Proportionen und den Grundriss des Bauwerks weniger überwältigend-autoritär erscheinen zu lassen. Hans Haacke thematisierte die ideologischen Konnotationen der Architektur des Pavillons im Kontext der Biennale. Im Rahmen seiner Arbeit Germania (1993) widmete er sich gezielt den Baumaterialien und der historischen Substanz, indem er den Marmorboden systematisch zerstörte. Haacke ging in seinem extrem ortsspezifischen Ansatz so weit, eine vergrößerte Schwarz-Weiß-Fotografie von Adolf Hitler und Benito Mussolini anzubringen, auf der die beiden Diktatoren zu sehen waren, wie sie im Jahr 1934 die Biennale von Venedig besuchten. Der rote Hintergrund im Eingangsbereich des Gebäudes erinnerte an die Farben der Fahne des Naziregimes. Die seitlichen Galerien wurden von Nam June Paiks episch proportionierter Videoinstallation Marco Polo (1993) eingenommen, welche die Verbindungen zwischen Asien und Europa durch Inblicknahme des Lebens dieses venezianischen Kaufmanns untersucht. Diese Werkpaarung ist ein früher Fall einer transnationalen Bespielung des Pavillons, welche den beiden Künstlern auch den Goldenen Löwen einbrachte. Haackes Ansatz erlaubte es allerdings nicht, Transkulturalität als Entschuldigung für historische Amnesie zu instrumentalisieren und stieß damals einem Großteil der deutschen Presse sauer auf. Germania untergrub alle Bemühungen, den Dialog der Kulturen, den der deutsche Pavillon 1993 gemäß der Preisverleihungs-Rede repräsentierte, zu entpolitisieren. 2022 kommt man bei einem Besuch von Venedigs berühmten Gärten nicht umhin, einen Blick auf das Geschehen jenseits des Settings der Kunstausstellung zu werfen: blutige Kriege, die menschengemachte Migrationskrise, die Zerstörung der natürlichen Umwelt und die neue Kriegstreiberei von Supermächten, zuletzt in der Ukraine und in deren Umgebung.

Seit den frühen 1990er Jahren setzt sich Eichhorn mit drängenden gesellschaftlichen Fragen auseinander und distanziert sich zugleich von dem Trend, gedankenlos durch die ständig im Wandel begriffene Liste an politischen Themen und sogenannten „alternativen Fakten“ unserer von (sozialen) Medien bestimmten, vermeintlich postpolitischen Zeit zu scrollen. Für die documenta 14 beispielsweise, die 2017 in Kassel stattfand und bei der ich als künstlerischer Leiter tätig war, gründete Eichhorn das nach wie vor existierende Rose Valland Institute, eine vielschichtige Arbeit, die sich mit der systemischen Plünderung von jüdischem Eigentum während des Naziregimes beschäftigt. Dieses scheinbar in Vergessenheit geratene Thema wurde wieder aktuell, als im November 2013 hitzige Debatten ausbrachen, nachdem das Magazin Focus die Entdeckung von 1600 verschollen geglaubten Kunstwerken durch die Staatsanwaltschaft an die Öffentlichkeit gebracht hatte. Diese Arbeiten waren von Hildebrand Gurlitt angesammelt worden, einer deutschen Kunsthistorikerin, Museumsdirektorin und Kunsthändlerin, die für den NS-Staat gearbeitet hatte.
Auf die Bitte, ihr Projekt für Venedig in wenigen Worten zu beschreiben, nennt Eichhorn die Frage der Zugänglichkeit als zentrales Anliegen: „Die Arbeit ist zugänglich. Sie kann sowohl gedanklich als auch vor Ort körperlich und in Bewegung erfahren werden.“3 Für zeitgenössische Kulturinstitutionen wie Museen oder Biennalen ist Zugänglichkeit ein beinah mythologisches Thema. Zweifellos ist sich Eichhorn, deren Werk oftmals als institutionskritisch beschrieben wird, dessen bewusst. Wir können uns nur denken, welche Folgen ihre Zuwendung zum Konzept der radikalen Zugänglichkeit hat, angesichts einer Welt, die mehr denn je entlang der Denkbilder der Grenze, der Selektion und der Exklusion organisiert zu sein scheint. Eichhorn kehrt ihre Position noch deutlicher hervor, indem sie einen wesentlichen Teil ihrer Arbeit an die Betrachter*innen delegiert: „Die Zugänglichkeit meiner Arbeit ist mir vor allem bei diesen großen Ausstellungen sehr wichtig. Deshalb versuche ich immer, mehrere Zugangsebenen einzubauen, um es den Besucherinnen und Besuchern zu erleichtern, die Arbeit zu rezipieren. Ich versuche auch immer, ihnen die Entscheidungsfreiheit zu lassen, sich aktiv oder passiv zu meiner Arbeit zu verhalten. Jede/jeder kann ihre/seine eigenen Gedanken daran anknüpfen, kann etwas anderes damit anfangen, bringt einen jeweils eigenen Hintergrund mit, eigene Gedanken und Erfahrungen.“4 Auf diese Weise beschrieben, bezieht sich das Konzept der Zugänglichkeit nicht bloß auf die technokratische Regulierung des physischen Zugangs, sondern auch auf die Erforschung des Ausmaßes der politischen Handlungsfähigkeit von Subjektivitäten in Bezug auf das Generieren von Bedeutung. Eichhorn bezieht Stellung hinsichtlich der Frage, welche Rolle der Kunst im Rahmen der Ermöglichung einer bedingungslosen Zugänglichkeit jenseits der Handlungsrahmen staatlicher Repräsentation zukommt: „Auch wenn Kunst in nationalen Pavillons gezeigt wird, bleibt Kunst, wie ich sie verstehe, international und kosmopolitisch, anarchisch, widerständig, politisch und polemisch, fragmentarisch, kritisch und unabhängig davon. Es ist nur eine vorübergehende Phase des Zeigens in diesen Pavillons und diesen Zusammenhängen. Kunst bleibt davon unabhängig.“5 Anstatt ein Plädoyer zu halten für die absolute Autonomie der Kunst, verweist Eichhorn auf die Möglichkeit einer Kunst, die einen politischen Raum jenseits staatlicher Kontrolle eröffnet.

Manchmal muss der Fußboden zu Bruch gehen, damit die Arbeit woanders fortgesetzt werden kann. 1993 – im Jahr von Haackes Germania – habe ich Eichhorns Arbeit zum ersten Mal gesehen, als kuratorischer Assistent am Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art in Warschau. Dort hat sie ihr Projekt Nordwestturm (Die Wiederaufnahme der Arbeit am Nordwestturm) realisiert, für das sie die geziegelten Lagen eines Turmes der ehemaligen königlichen Residenz Schloss Ujazdów verputzte Der originale Barockpalast von Ujazdów wurde während des Warschauer Aufstandes 1944 beschädigt, später abgerissen und schließlich zwischen 1974 und 1984 wieder aufgebaut. Er beherbergt ein neues Zentrum für zeitgenössische Kunst, das 1989, in einer Zeit politischer und ökonomischer Umbrüche in Polen, mit neuer Energie seine Arbeit aufnahm. Das Zentrum bietet Platz für eine damals neu geschaffene Sammlung zeitgenössischer Kunst sowie für temporäre Ausstellungen mit Arbeiten polnischer und internationaler Künstler*innen. Aufgrund eines Mangels an Fördergeldern während des langwierigen Rekonstruktionsprozesses konnten die Arbeiten an den vier Türmen des Schlosses vorerst nicht abgeschlossen werden. Eichhorns Vorhaben zielte darauf ab, das für ihre Ausstellung vorgesehene Produktionsbudget für das Verputzen eines der Türme zweckzuentfremden – ein Beitrag zur Vollendung der Restauration. Für alle zugänglich, war der beige verputzte Turm nun eine sichtbare Anomalie in dem Park, der das Schloss umgibt. Er stach deutlich hervor im Vergleich zum rötlichen Backstein der drei anderen unverputzten Türme. Die Intervention der Künstlerin – eine Fortsetzung der Wiederaufbauarbeiten, die vorübergehend unterbrochen und auf einen Teil des Gebäudes beschränkt worden waren – hatte weitreichende Konsequenzen, sie positionierten den Turm an einer Schnittstelle zwischen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Anstatt offenkundig Kritik zu üben, machte sich Eichhorn die Geschichte des Gebäudes zunutze und enthüllte vor dem Hintergrund von Polens damaliger rapider und brutaler ökonomischer Transformation auf schlaue Weise die brisante finanzielle Lage der Institution.

Beinahe 30 Jahre später zu der Architektur des deutschen Pavillons als Symbol der Naziära befragt, antwortet Eichhorn: „In Bezug auf den Deutschen Pavillon in Venedig teile ich die Auffassung von Hans Haacke und anderen, dass der Pavillon historisch betrachtet als Mahnmal erhalten bleiben sollte. Geschichte, die sich auch durch Architektur vermittelt, kann nicht einfach abgebaut und weggelogen werden, wie beim Palast der Republik in Berlin geschehen, an dessen Stelle eine Schloss-Attrappe errichtet wurde.“6 Eichhorns prägnantes Statement verbindet wiederkehrende Debatten um die Naziarchitektur des deutschen Pavillons mit gegenwärtigeren Auseinandersetzungen um die historistische Rekonstruktion des preußischen Berliner Schlosses als ein Museum für „Weltkultur“. Das Schloss und das Museum sind Gegenstand einer laufenden Kontroverse und ein Beispiel für Deutschlands Erinnerungspolitik, die unterschiedliche Gangarten an den Tag legt, was die frühere Kolonialgeschichte und die jüngere Nazivergangenheit des Landes betrifft. Dass es sich dabei nicht bloß um eine Frage der Überpolitisierung handelt, beweist der relative Mangel an Interesse, den die deutschen Medien hinsichtlich der Umsetzung einer dekolonialisierenden Praxis im Rahmen der documenta fifteen an den Tag legten. Deren Kurator*innen, das indonesische Künstler*innenkollektiv ruangrupa, wurden als Antisemit*innen bezeichnet, und es wurden Anschuldigungen laut, dass einige der bei der documenta fifteen vertretenen Künstler*innen Partei ergreifen würden für die BDS-Kampagne, die 2019 durch das deutsche Parlament als antisemitisch eingestuft wurde.
Es ist vorstellbar, dass Eichhorns Arbeit für den deutschen Pavillon künftig als situierte Stimme im Rahmen einiger der fortlaufenden Debatten vernommen wird. Eichhorn bringt sich bereits seit Jahrzehnten in diese Kontroversen ein, deren Ziel darin besteht, vorherrschende Standpunkte zu dekonstruieren. Sie merkt an: „Der Deutsche Pavillon ist symbolisch aufgeladen und stellt für Künstler*innen eine Herausforderung dar, auf mehreren und ganz unterschiedlichen Ebenen. Bei jedem Dekonstruktionsversuch wird man darauf zurückgeworfen, hat aber auch Spaß dabei. Ohne davon abzurücken, betrachte ich den Deutschen Pavillon nicht isoliert, sondern im Ensemble und Wechselspiel mit anderen Pavillons und Länderbeteiligungen in Bezug auf staatlich-territoriale und geopolitische, globale ökonomische und ökologische Entwicklungen.“7

Das macht den deutschen Pavillon so so andersartig, so reizvoll als Ort, an dem Arbeiten geschaffen werden können und man über den eigenen Tellerrand hinausschauen kann. Eichhorn kommentiert ihre Position als individuelle Künstlerin, die mit einem überdeterminierten Kontext ringt, und deutet damit ein anderes Verständnis von Identität an, jenseits einer bestimmten Zugehörigkeit. Diese Identität umgeht die Sackgasse der Identitätspolitik, indem sie in den Hintergrund rückt, sobald die Arbeit getan ist: „Die meisten Künstler*innen, die einen Pavillon bei der Biennale bespielen – das gilt auch für den deutschen –, sehen ihre Aufgabe einfach darin, entweder ihre übliche Arbeit fortzuführen bzw. auszustellen oder Missstände anzuprangern, politische Entscheidungen zu hinterfragen, Formen des solidarischen Austausches zwischen gesellschaftlichen Gruppen zu initiieren, einen Standpunkt zu vertreten etc. Meiner Ansicht nach sind Künstler*innen keine Repräsentant*innen eines Landes, sondern einer Geisteshaltung, einer gewissen Art zu denken und zu agieren angesichts einer bestimmten Situation. Was die Frage der Zugehörigkeit betrifft: Ich verstehe mich als eine Mischung aus multiplen Identitäten und Nicht-Identitäten und unterscheide zwischen meinen verschiedenen Ichs. Nicht ich als Person, sondern meine Arbeit sollte die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Ich mache meine Kunst und trete dann in den Hintergrund.“
Maria Eichhorns Ausstellung im Deutschen Pavillon auf der 59. Biennale von Venedig wird von 23 April bis 27 November 2022 zu sehen.
Dieser Artikel erschien zuerst auf Englisch in der frieze Ausgabe 226 mit der Überschrift ‘Maria Eichhorn’. Weitere englischsprachige Berichte über die 59. Biennale von Venedig finden Sie hier.
Erste Abbildung: Maria Eichhorn, Maria Eichhorn Aktiengesellschaft, 2002, Ausstellungsansicht, Documenta11, Kassel. © Maria Eichhorn/VG Bild-Kunst, Bonn/DACS, London; Foto: Werner Maschmann
1 Maria Eichhorn im Gespräch mit Yilmaz Dziewior, Deutscher Pavillon, 17 Februar 2021, www.deutscher-pavillon.org/media/de-dpv_pressemappe.pdf
2 Maria Eichhorn im Gespräch mit Gerd Roth, dpa Deutsche Presse-Agentur, 29 December 2021, www.muensterschezeitung.de/nachrichten/kultur/maria-eichhorn-kunst-ist-anarchisch-und-widerstaendig-2510304
3 Maria Eichhorn im Gespräch mit Yilmaz Dziewior, Deutscher Pavillon, 17 Februar 2021
4 Maria Eichhorn im Gespräch mit Gerd Roth, dpa Deutsche Presse-Agentur, 29 December 2021
5 Ibid
6 Maria Eichhorn im Gespräch mit Yilmaz Dziewior, Deutscher Pavillon, 17 Februar 2021
7 Ibid